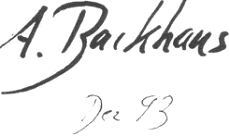Dr. A. Backhaus: Vortrag am 15.Dezember 1995
im Orthodoxen Bildungszentrum Berlin
Verstand und Gebet
Bevor wir das Problem des Denkens, Glaubens und Betens betrachten, möchte ich zunächst zwei Geschichten erzählen, beide sollen wahr sein:
Die erste Geschichte von einem kleinen Jungen, der in den Alpen aufwuchs und für unsere Begriffe wohl ein Debiler, wenn nicht ein Idiot war. Also jemand der nicht klar denken konnte. Der Pfarrer des Ortes versuchte ihm den Glauben beizubringen, und da er das nicht so richtig verstand, zeigte er ihm das an der Hand und sagte: ICH bin der HERR Dein GOTT.
Das mußte der kleine Junge lernen. Und er saß dann auch häufig da, wenn er nachdachte oder spielte, und dann nahm er seine Hand: ICH bin der HERR Dein GOTT. Eines Tages stürzte dieser Junge ab, und wurde tot gefunden zwischen den Felsen und hatte den Finger mit der anderen Hand erfaßt, der für GOTT steht, so daß er offensichtlich, wenn man an Zeichen etwas erkennen kann, das Wesentliche des Glaubens begriffen hatte.
"ICH bin der HERR Dein GOTT."
Im Augenblick seines Todes, wo ja wohl die geistige Beschränkung aufhört, hat er diesen Finger ergriffen. Das zeigt offenbar, daß das, was wir denken nennen, das heißt logisches, diskursives, abstraktes Denken, für den Glauben völlig "unnötig" ist.
Ein Freund aus Japan erzählte mir, wie ein Franziskaner, der dort die Japaner zu missionieren versuchte, als junger Mönch nach Japan kam und dort, schlecht japanisch sprechend, aus seinem Katechismus den interessierten und neugierigen Japanern den katholischen Glauben vorlas. Die waren so begeistert, daß sie alle katholische Christen wurden. Viele, viele Jahre später, als er nun wirklich japanisch konnte, begann er mit denselben Menschen vom Glauben zu sprechen. Und die fielen von einem Erstaunen ins Andere, und sagten: so herrlich ist der Glaube. Was ist das für eine Sache, was ist das für eine großartige Sache! Und da sagte der Mönch: ich habe Euch das doch alles schon vorgelesen. Ja, sagten die höflichen Japaner, wir haben kein Wort verstanden, was Du da gesprochen hast, war für uns unverständlich. Aber Dein begeistertes Gesicht, das hat uns überzeugt. Aber als sie dann verstanden, was mit dem Glauben ist, da waren sie davon ganz begeistert.
Der Glaube wird schöner, genauer, herrlicher, wenn man ihn eben auch mit dem Verstande ergreift.
Ich will jetzt an zwei Punkten eigentlich diese Verbindung von unmittelbarer Begegnung, Beten und Denken mit Ihnen besprechen.
Einmal angesichts der Eucharistie, angesichts des Empfanges des Heiligen Abendmahls, was ja grundsätzlich und von Anfang an über unser Verstehen hinausgeht. Und was doch, wie ja gerade die Geschichte der Kirche zeigt, immer wieder zu sehr subtilen und sehr präzisen Denkansätzen und Denkversuchen geführt hat, sogar dazu geführt hat, daß Calvin auf der einen Seite, Luther auf der anderen Seite, und die katholische Kirche mit der Realpräsenz, sich um der rationalen im Denken ergriffenen Wirklichkeit des Heiligen Abendmahls so zerstritten haben, daß daraus verschiedene Kirchen wurden.
Und das zweite Thema ist der Tod. Mit dem geht es uns ja auch so. Wir wissen alle, daß wir sterben müssen, und ab und zu beschäftigen wir uns auch damit, manche bereiten auch schon ihre Beerdigungszeremonie vor und haben schon einen Stein machen lassen oder haben schon irgendwo ein Stück Erde dafür gekauft, andere Völker tun das, viel intensiver als wir, und trotzdem ist der Tod etwas, was mit unserem Verstand und mit unserem Denken nicht ganz zu durchdringen ist. Und auch hier meine ich, daß die Einheit von Gebet und Denken von Glauben und Nachsinnen uns eine ganz neue Welt und Wirklichkeit eröffnet.
Beide Gebetsformen, die Vorbereitung auf das Heilige Abendmahl, und das Gedenken oder das gemeinsame Gebet mit den Entschlafenen ist für den orthodoxen Christen eines der häufigsten Gebete.
Ich habe mal versucht, auszurechnen - ich bin 1950 zum Priester geweiht worden - und selbst wenn ich nur zweiundfünfzig Mal im Jahr die göttliche Liturgie gefeiert habe, jedesmal die Gebete gelesen habe, kann man sich ausrechnen, daß das ziemlich häufig ist, etwa zweitausenddreihundertundvierzig mal.
Und immer wieder, wenn ich die Gebete neu lese, bin ich erstaunt, was alles darin steht, daß ich offenbar in diesen fast fünfzig Jahren, in diesen vielen Tausend mal, wo ich die Gebete gelesen habe, die Gebete doch noch nicht ganz begriffen und ergriffen habe.
Als ich zum Priester geweiht wurde, am Karfreitag, gleichzeitig Mariä Verkündigung, das fiel damals zusammen, kam nach dem Gottesdienst der alte Vater Stephan Lyaschewski zu mir und sagte: Komm, gehe noch nicht weg, wir müssen jetzt eine Panichida halten, so nennen die Orthodoxen das Gebet mit und für die Entschlafenen.
Panichida - vom griechischen Wort: die ganze Nacht, bezeichnet bei den Russen einen Gebetsgottesdienst in Erinnerung der und zur Gemeinschaft mit den Entschlafenen. Der Gottesdienst entspricht der Form der Beerdigung, ist aber verkürzt. (Lesungen aus der Heiligen Schrift, manche Gesänge werden ausgelassen.) Die Form des Beerdigungsgottesdienstes entspricht der Struktur des Morgengottesdienstes, des Orthros.
In der Karwoche feiert die Kirche am Karfreitag mit einem solchen Orthros die Grablegung Christi. So ist die Grablegung des Christen vorgebildet in der Grablegung Christi, wie es sich auch in der Form des Ritus ausdrückt.
Das Totengedenken, die Panichida, wird am Todestag, am 3., am 9., am 40.Tag, auch am Namenstag oder Geburtstag des Verstorbenen gefeiert. Die Sonnabende der Fastenzeit sind Tage, an denen in besonderer Weise der Entschlafenen gedacht wird.
Und Vater Stephan sagte: Dies ist das aller Wichtigste, das wirst Du in Deinem Leben am aller-häufigsten beten und singen müssen. Und er hatte völlig recht. Ich kann die wenigen Gottesdienste in Lübeck oder Hamburg oder Schleswig oder Berlin zählen, bei denen nicht nach dem Gottesdienst noch jemand kommt, und um ein solches Gebet bittet. Offenbar sind diese beiden Gebetsformen den orthodoxen Christen außerordentlich vertraut.
In den Gebeten vor der Kommunion
[1]
heißt es in einem Lied: "Nun heilige in mir, Erlöser, den Geist, die Seele, das Herz und auch den Leib, und mache mich würdig, mein Gebieter, Deinen furchtbaren Geheimnissen unverurteilt zu nahen." (6.Ode, 1.Vers, Seite 158)
Diese Gebete bestehen einmal aus einem sogenannten Canon, der mit einem einleitenden Lied, einer Ode, beginnt der in der Regel vier Verse folgen. Zwischendurch werden Verse aus dem fünfzigsten (einundfünfzigsten) Psalm (50/1,12+13) gebetet. darauf folgen 12 Gebete und kurze Verse.
Aber wenn man nun anfängt, darüber nachzudenken, oder wenn man die Gebete immer wieder betet und liest, dann wird einem erst offenbar, das dieser ganz einfache Text eigentlich alles enthält:
Nun heilige in mir Erlöser,
den Geist und die Seele,
das Herz und auch den Leib.
Die Ganzheit des Menschen, der Leib und Seele, Geist und Verstand, viele Dinge in sich trägt, wird hier in diesem Gebet in einer sehr einfachen, aber auch sehr eindrucksvollen Weise ausgesagt. Das ist für meine persönliche Erfahrung sehr viel besser und eindrucksvoller, als viele philosophische und theologische Diskussionen, über die Drei-geteilt-heit des Menschen, Geist, Seele und Leib; die zwei-geteilt-heit des Menschen, oder wie man das auch immer im Einzelnen beschreiben wird. (Siehe: Dichtomismus, Trichotomismus z.B. kleines theologisches Wörterbuch, Herder, 108/9)
Wenn ich mich betend, aber auch nachdenkend, den unbegreiflichen und doch zu ergreifenden Geheimnissen GOTTES nahe, dann wird mir erst deutlich, was sich im Mysterium, im Sakrament ereignet und geschieht. Und dann wird gleichzeitig diese Einsicht, diese Begegnung aus meinem eigenen Sein, aus Geist, Seele, Herz, Leib zu dem Ausgangspunkt meiner Hinwendung zu Gott: "Mache mich würdig, mein Gebieter, Deinen furchtbaren Geheimnissen unverurteilt zu nahen." (6.Ode, 1.Vers,S.158)
Wenn ich so an Predigten und Gespräche denke, dann ist gerade dieses Wort von den "furchtbaren" Geheimnissen ein Anlaß zu Fragen und Zweifel.
Nicht erst der moderne Mensch, aber auch der moderne Mensch meint, daß er nicht in Furcht und Zittern vor Gott stehe, er sei erwachsen. Als erwachsener Mensch ist das ein etwas kindliches, unwürdiges Gefühl: Furcht und Zittern. Wollen wir davon noch reden?
Aber das Erstaunliche ist, daß, wenn wir uns einer wesentlichen Entscheidung unseres Leben gegenüberstehen, daß, wenn wir ein Bewerbungsgespräch geführt haben und darauf warten, ob wir vielleicht die Stelle bekommen, daß wir eben dann, Furcht und Zittern sehr deutlich verspüren.
Ist die Begegnung mit GOTT offensichtlich nicht weit wichtiger, als die Frage, ob wir die Stellung, um die wir uns beworben haben, bekommen werden? Darum dürfen wir natürlich in der Begegnung mit GOTT, wie die Gebete sehr deutlich sagen, erschauern vor dem furchtbaren Geheimnis, daß GOTT uns entgegen kommt.
Die vierte Ode: (S.156):
Du kamst aus der Jungfrau
Nicht ein Vermittler
[2]
Auch nicht ein Engel
Sondern, Du selbst, o HERR
hast Dich verkörpert
und erlöst den ganzen Menschen, mich
Darum rufe ich zu Dir
Ehre sei HERR DEINER MACHT
Sie wissen wahrscheinlich, daß die Slawenapostel Methodius und Kyrill, aber auch ihre Nachfolger, die griechischen Texte in einer solchen Präzision oder in einer solchen einfachen Weise übersetzt haben, daß man aus dem ursprünglichen slawischen Text ohne Schwierigkeiten auf den griechischen rückschließen kann, aber gerade deshalb ist es manchmal außerordentlich schwierig zu erkennen, was für ein deutsches Wort dem ursprünglich entspricht. Du kamst aus der Jungfrau, nicht ein Vermittler. Offenbar jemand, der für einen anderen vermittelt.
Und selbst wenn in den nicht-christlichen Religionen Gott Mensch wird, ob das nun Zeus oder Jupiter ist, so nur vorübergehend. Heidnische Götter legen nur mal das Gewand eines Menschen an, um es später wieder abzulegen, und in den göttlichen Raum, den "Olymp", wieder zurück zu kehren.
Und in diesem Vers ist alles enthalten, was die Einmaligkeit des Christentums ausmacht. Wir haben nicht sehr viel vorzuweisen als Christen, als besonders wichtige und wertvolle Eigentümlichkeit unseres Christlichen Lebens, wir sind nicht klüger, wir sind nicht besser, wir vertragen uns nicht besser als andere, aber das GOTT DER HERR nicht als ein Vermittler, nicht als ein Engel, sondern selbst zu uns gekommen und Mensch geworden ist und bleibt, ist völlig unabhängig von der Frage, ob wir das glauben, oder für richtig halten, eine einmalige, im Denken der Menschen niemals wiederholte Verkündigung, die uns nur von Christus gesagt ist.
Sondern Du selbst o HERR hast DICH verkörpert
und erlöst den ganzen Menschen, mich.
Hier taucht wieder der ganze Mensch auf, (wßego mja tscheloweka), Christus erlöst den ganzen Menschen, eben nicht nur meine Seele, nicht nur meinen Leib, nicht nur mein Denken, nicht nur mein Ich, oder wie man das immer bezeichnen mag, sondern die ganze Fülle meines Daseins.
Darum rufe ich zu Dir, o HERR:
Ehre sei Dir
Jetzt ein Text aus dem Theotokion, das Maria, die Mutter des Herrn als Gottesgebärerin bekennt, als Theotokos: (THEO=GOTT, tokos-die Erzeugung, das Gebären, die Geburt) Bekenntnis des gemeinsamen Konzils der ganzen Kirche zu Ephesus 431. Jedes Lied: Ode und vier Verse schließt mit einem Vers auf die Gottesgebärerin, der das Geheimnis immer neu beschreibt, daß Gott aus Maria wahrer Mensch geworden ist, DER von Ewigkeit zu Ewigkeit wahrer Gott ist. So gedenkt die Kirche in diesem Vers der Mutter unseres HERRN JESUS CHRISTUS, der Jungfrau Maria, weil, und ich meine, das ist auch präzise logisches Denken, nur in der Betrachtung und dem Nachsinnen über das unbegreifliche Geheimnis, daß Gott aus einer Frau Mensch geworden ist, die Wirklichkeit der Menschwerdung überhaupt erahnbar wird:
Maria, Mutter Gottes
ehrbares Gefäß duftenden Wohlgeruches
laß mich doch durch Deine Gebete
zum Gefäß der Auserwählung werden
und an den Weihen Deines Sohnes teilhaben.
(5.Lied, Theotokion, S.157)
Es ist interessant, daß die alten Sprachen hier einen feinen Unterschied machen, der im Deutschen vielleicht gar nicht so wiederzugeben ist: ehrbares Gefäß - Selénii - auf slawisch, das heißt eigentlich: "Wohnsitz" duftenden Wohlgeruches. Raum, der GOTT umschlossen hat.
Laß mich durch Deine Gebete zum Gefäß: - soßud - eben praktisch wirklich einfach zum "Gefäß", zum Raum Deiner Auswerwählung, zum Raum in den Du eintrittst, werden.
Und zugleich zeigt dieser Text wiederum etwas von der Theologie der Gottesgebärerin und Mutter des HERRN JESUS CHRISTUS: daß sie immer die ist, die uns zwar voran geht, der wir nachfolgen, auch wir werden, im Empfang des Heiligen Abendmahls zum Raum, zum Gefäß, in dem Gott gegenwärtig ist.
Die orthodoxe Kirche zeichnet sich meiner Meinung nach dadurch aus, daß sie am häufigsten und am meisten um die Erleuchtung des Verstandes betet.
Die orthodoxe Kirche ist erfüllt von einer Weite, die alle Dimensionen menschlicher Existenz umfaßt: Erlöse mich, den ganzen Menschen. Und als, ich meine, Athanasius von Alexandrien gefragt wurde, wie sich der Glaube vom Wissen unterscheidet, hat er geantwortet: Im Wissen ergreifen wir die Welt durch Denken und Beobachten um sie uns handhabbar zu machen. Im Glauben ergreifen wir die Wirklichkeit GOTTES, die Welt als Schöpfung GOTTES, durch Denken, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Handeln, Mit-Handeln, durch die ganze Weite unserer Existenz. Und darum ist es sehr verständlich, daß es zum Gebet, zur Bitte an GOTT gehört, daß er unseren Verstand erleuchtet. "Erleuchte meinen Verstand und mein Herz," betet jeder orthodoxe Christ beim Morgengebet.
Vom Schlaf und Lager hast DU mich aufgerichtet
HERR, erleuchte meinen Verstand und mein Herz
und öffne meine Lippen, damit ich DICH preise
Heilige Dreifaltigkeit
Heilig, Heilig, Heilig, bis DU, o GOTT
erbarme Dich unser um der Gottesgebärerin
(Aus Morgentroparion zur Heiligen Dreifaltigkeit Seite 8/9)
Und in dem zweiten Gebet, zur Vorbereitung auf das Heilige Abendmahl, beten wir um die Erleuchtung und Heiligung des Verstandes:
Ihr Gläubigen
lasset uns für die Katechumenen
[3]
beten, daß der Herr sich ihrer erbarme
Daß ER sie lehre das Wort der Wahrheit
Daß ER ihnen offenbare
das Evangelium der Gerechtigkeit
(Göttliche Liturgie, Gebet für die Katechumenen, S.72)
und um die Erneuerung des Herzens. Auch im Gebet für die Katechumenen, für die Ungetauften, bittet die Kirche immer wieder darum, daß das Wort der Wahrheit sie lehre, daß ihnen offenbar werde das Evangelium der Gerechtigkeit.
Nach dem Empfang des Heiligen Abendmahls beten wir mit dem Heiligen Simeon Metaphrastos im dritten Gebet, daß durch den Empfang des heiligen Abendmahls die Fünfzahl (pjateriza) meiner Sinne erleuchtet werde möge. (S.189)
Ich erinnere mich an eine Schwierigkeit, die ich als junger orthodoxer Priester hatte: Es wird da gebetet für die Unwissenheit des Volkes.
In der orthodoxen Liturgie betet der Priester während der Ektenie, der Litanei für die Unwissenheit des Volkes:
"nimm an das Gebet von uns Sündern
und lasse es gelangen
zu Deinem Heiligen Altar
und befähige uns
Dir Gaben und geistliche Opfer
darzubringen für unsere Sünden
und für die Unwissenheit des Volkes
(Gebet zur Ektenie nach dem Cherubimlied.)
Mir gefiel das eigentlich nicht so recht, und ich kam mir eingebildet und hochmütig vor, daß ich nun als junger Priester, da am Altar stehend, für die Unwissenheit des Volkes betete.
Und mir ist klar geworden, wie sinnvoll und heilsam diese Bitte ist: an einer ganz anderen Fragestellung: möchte ich nicht, daß man für meine Unwissenheit betet? Und nachdem ich diesen Gedanken so formuliert oder so begriffen hatte, habe ich erst begriffen, natürlich möchte ich, daß man für meine Unwissenheit betet, nicht nur vor einer Prüfung, die ich bestehen möchte, sondern jeden Tag.
Zur Erkenntnis des Evangeliums gehört das Gebet, in allen Kirchen, in den lutherischen Ausgaben der Bibel stehen am Anfang in der Regel Sätze von Luther oder von dem Herausgeber, die sagen, im Gebet muß man dieses Wort Gottes lesen.
"Da muß nun das Gebet das erste sein, und ein Einfältiger auf diese oder dergleichen Art und Weise, ehe er die Bibel lieset, Gott anreden, nicht mit dem Mund allein: SONDERN MIT RECHT ANDÄCHTIGEM HERZEN:
"O DU ewiger und lebendiger Gott, wie können wir DIR genugsam danken, daß DU uns Deinen heiligen Willen in Deinem Wort so gnädiglich offenbart hast, daß wir daraus lernen können, wie wir gläubig, fromm und selig werden sollen. So gib mir nun Deinen heiligen Geist, daß ER mir die Augen öffne, zu sehen die Wunder an Deinem Gesetz, daß ER durch Dein Wort den Glauben in meinem Herzen mehre, und meinen Willen kräftiglich lenke, daß ich mich freue über Deine Zeugnisse und von Herzen an Dich glaube und Wort halte."
(August Herrmann Franckes kurzer Unterricht, wie man die Heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen solle; Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, Dresden, Sächsische Haupt-Bibel-Gesellschaft, Anhang, Seite 69)
(IN der Einheitsübersetzung, 1980, ISBN 3-460-31941-0 fehlt ein Wort vom Gebet beim Lesen der Heiligen Schrift)
In der Göttlichen Liturgie betet die orthodoxe Kirche vor der Lesung des Evangeliums:
Laß leuchten in unserem Herzen, menschenliebender Gebieter, das lautere Licht Deiner Gotteserkenntnis und öffne die Augen unseres Verstandes dem Verständnis der Verkündigung Deines Evangeliums.
Lege in uns die Furcht Deinen seligen Gebote, damit wir, nachdem wir die Begierden des Fleisches überwunden haben, zu einem geistlichen Wandel gelangen und alles nach Deinem Wohlgefallen sinnen und tun. denn Du bist die Erleuchtung unserer Seelen und Leiber, o Christe, Gott, und Dir bringen wir Ehre dar bei Deinem anfangslosen Vater, dem allheiligen und guten und lebendig machenden Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.
(Gebet vor der Lesung des heiligen Evangeliums: Göttliche Liturgie des Hl.Johannes Chrysosomos/d.Hl.Basiliusd. Großen)
In der Vorbereitung auf das Hören des Worts Gottes ist das Gebet und die Reinigung des Herzens die Grundlage aus dem Evangelium die Stimme des Herrn zu hören, DER zu uns spricht. Zugleich, im gleichen Atemzug ist unser Verstand aufgerufen, des Wortes Weite, Tiefe, Sinn und Zusammenhänge zu begreifen. Vielleicht ärgert sich der Verstand über die Worte: "nachdem wir die Begierden des Fleisches überwunden haben", aber gerade unsere moderne Einsicht in die vielfältigen Zusammenhänge des Erkennens bestätigen, daß die Atmosphäre in der der Verstand nach Wahrheit und Erkenntnis sucht, für das Ergebnis wesentlich ist.
In den Seligpreisungen heißt es ja:
"Selig sind die reinen Herzens sind,
sie werden GOTT schauen."
[4]
Wenn ich das ernsthaft betrachte, spüre oder erkenne ich, weiß ich und sehe, daß die Schwierigkeiten GOTT zu erkennen und an GOTT zu glauben oder GOTT zu lieben, nicht darin liegen, daß wir nicht intelligent genug sind, sondern, daß die Verdüsterung unseres Herzens, die Unordnung in unserem Herzen uns daran hindert, GOTT zu erkennen. Deshalb müssen wir "die Begierden überwinden". Wir müssen in unserer eigenen Welt, in unserem eigenen Leben eine richtige, zuverlässige, auf GOTT gerichtete Hierarchie der Werte herstellen
[5]
.
Aber es gibt viele solcher seltsamen Worte. In den Gebeten vor dem Abendmahl zitiert der Beter den heiligen Apostel Paulus, 1.Thimoteus 1,15:
Ich glaube und bekenne, daß dies ist wahrhaftig
CHRISTUS der SOHN GOTTES,
der in die Welt gekommen ist,
die Sünder zu erretten,
deren ich der Erste bin.
Auch ein sehr seltsamer und auch etwas anstößiger Satz. Natürlich bin ich ein großer Sünder. Das sage ich ja immer wieder, ich weiß es eigentlich nicht, ich glaube es auch nicht richtig. Aber es wird immer wieder gesagt, daß ich ein großer Sünder sei, aber daß ich nun gleich der Erste sein sollte?
Ich glaube der heilige Apostel Paulus meint: der Erste bei GOTT. Nicht der erste Sünder in der Hierarchie der Sünder, sondern: protos eimi ego - primus ego sum, das ist griechisch bzw. lateinisch, und sehr schön: der erste bei Gott. Das ist das Geheimnis des Heiligen Abendmahls: die heilige Kirche ist nichts anders als die Gemeinschaft der Menschen, die GOTT, den Unsichtbaren, der Mensch geworden ist, in sichtbarer Gestalt in seinem Wort, in der Verkündung des Evangeliums, im Heiligen Abendmahl in Seinem Leib und Blut herbeiträgt, so daß jeder der Erste ist. Wenn ich auf den Kelch zugehe und den Leib und das Blut des HERRN JESUS CHRISTUS empfange, bin ich der Erste. Zwischen mir und dem Kelch ist nichts und niemand mehr. Und eben gerade dieses Erstaunen und dieses vielleicht umständliche Überlegen, was eigentlich der Heilige Apostel Paulus hier meint, führt, mich jedenfalls, aber auch die Väter, die darüber genau so berichten, zu der Erkenntnis, daß er hier etwas ganz Wesentliches sagt. Das Großartige der Menschwerdung Gottes ist, daß ich der Erste bei Ihm bin, daß niemand mehr dazwischen ist, sondern, daß, wenn ich auf ihn zugehe, meine Hände oder meine Lippen unmittelbar nur IHN berühren und nichts mehr zwischen Gott und mir ist, bis in die leibliche Wirklichkeit.
In den Gebeten vor dem Abendmahl kommt immer wieder das hochzeitliche Gewand vor. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch über das Gleichnis mit dem hochzeitlichen Gewand /
[6]
geärgert haben. Das ist wieder so ein Gleichnis des HERRN JESUS CHRISTUS, mit dem ich nicht so leicht einverstanden bin. Da sind die Leute von den Straßen und Hecken herbeigeholt, weil die richtigen Gäste nicht gekommen sind. Die sitzen jetzt alle am großen Tisch beim Hochzeitsmahle des Königs, und der König geht dadurch und plötzlich sieht er einen, der hat kein hochzeitliches Gewand an "und sprach zu ihm: Freund, wie bist Du hier hereingekommen und hast kein hochzeitliches Gewand an?" ER aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: "Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappen." (Matth.22,12-13) Was kann der arme Kerl dafür? Wenn er von den Hecken und Straßen hereingeholt wird, er konnte ja gar nicht mehr nach Hause.
Hier ist nun allerdings einfach die historische Wirklichkeit die zutreffende Antwort. In den Hochzeitsfeiern, das kennen wir auch aus dem Alten Testament, natürlich, Israels, aber überhaupt des ganzen Orients, bekam jeder Gast ein hochzeitliches Gewand an der Tür. Es war das Geschenk des Hausvaters, daß ihn würdig machte, an dem Abend Mahl, an der Feier teilzunehmen. Wir kennen das heute nur noch zu Silvester, wenn wir zur Silvesterfeier kommen, bekommt jeder zum Beispiel ein Hütchen auf. Das ist eine späte Erinnerung an einen alten Brauch.
Gewänder spielen auch in der damaligen Welt eine große Rolle; sie sind oft Zeichen der Ehrerbietung, oft Ehrengeschenke. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Damaskus, vom Aussatz befallen, kommt zum Propheten Elisa, sucht bei ihm Heilung. Sein Herr gibt ihm Geld und zehn Festkleider
[7]
als Geschenk mit. Das Gewand wird zum Ausdruck des eigenen Wesens, der Würdigkeit. Gott macht Adam und Eva, von der Sünde entstellt, Kleider
[8]
. Priester des Alten Bundes legen liturgische Gewänder an, wenn sie dem Herrn dienen, das Gewand wird zum Zeichen der Würdigkeit
[9]
. Der orthodoxe Priester erlebt beim Anlegen der liturgischen Gewänder, daß es nicht seine Fähigkeit und Würde ist, die ihn zum Dienst am Altar, zur Verkündigung des Wortes ruft, sondern Gottes Gnade, die im Gewand zeichenhaft, spürbare Gestalt annimmt.
"reinige meine Seele und mein Herz vom bösen Gewissen und befähige mich, den DU mit der Gnade des Priestertums bekleidet hast, durch die Kraft Deines Heiligen Geistes, vor diesem Deinem heiligen Tisch zu stehen und heilig zu handeln an Deinem heiligen und allreinen Leib und Deinem kostbaren Blut" (Gebet vor dem großen Einzug, göttliche Liturgie)
"Meine Seele freut sich im Herrn, denn ER hat mich bekleidet mit dem Gewand des Heils und mich umhüllt mit dem Kleid der Freude..." (Gebet beim Anlegen des Sticharon, Untergwand; Jesaja 61,10).
Jedenfalls dieser Mann hat kein schlechtes Gewand an, sondern, es war ein eingebildeter Bursche, der sein Gewand für besser hielt, dem das Gewand nicht gefiel, das der Hausvater ihm an der Tür anbot. Er hielt seinen eleganten modernen Smoking für sehr viel besser, als dieses altertümliche Gewand, das er da bekommen hatte. Deshalb ist der Herr, berechtigter und verständlicher Weise, so zornig
[10]
.
Und deshalb sagen immer wieder die Gebete: HERR, gib mir das hochzeitliche Gewand, daß ich würdig werde, an DEINEM heiligen Abendmahl teilzunehmen.
So bekennen wir in diesem Gebet immer wieder, daß wir darauf angewiesen sind, daß der Hausvater, der HERR JESUS CHRISTUS, uns würdig macht, uns dieses Gewand gibt, uns überkleidet
[11]
.
"Wie soll ich Unwürdiger in den Glanz Deines Heiligtums eintreten? Denn, wenn ich wagte, in das Brautgemach einzutreten, wird das Gewand mir zum Vorwurf gereichen, weil es nicht hochzeitlich ist, und gefesselt werde ich hinausgeworfen von den Engeln: Tilge o Herr, den Makel meiner Seele und erlöse mich!" (Tropar vor dem Empfang des heiligen Abendmahls, Seite 158/6)
Es gibt eine Dynamik, die auch in den Gebeten immer wieder vorkommt, ich meine eine Dynamik, die durch die gesamte Heilige Schrift hindurch geht, und die uns deutlich macht, daß wir auf einem Wege sind, der noch nicht abgeschlossen ist, von dessen fernem Ziel wir aber etwas ahnen.
Der Dornbusch kommt immer wieder vor, der Dornbusch, den Moses in der Wüste sieht, der Dornbusch, der brannte und nicht verbrannte, und als Moses herankommt, hört er eine Stimme, die Stimme GOTTES. DER sagt: "Das ist heiliger Boden, zieh Deine Schuhe aus"
[12]
, und GOTT redet aus dem Dornbusch mit Moses.
Das Problem dieses Dornbusches ist nicht so einfach zu lösen, wie das gerne versucht wird. In der gemeinsamen Bibelübersetzung der evangelischen und katholischen Kirche steht in der Fußnote, das war wohl ein Elmsfeuer
[13]
. Ein Elsmfeuer kommt in der Wüste nicht vor.
Andere meinen, es wäre ganz natürlich, daß in der großen Hitze der Wüste mal ein Dornbusch anfängt zu brennen, nur dann verbrennt er eben auch. Dieser Dornbusch ist etwas Ungewöhnliches: ist Gottes Gegenwart, und weist auf etwas hin, was für unser alltägliches Leben eine entscheidende Rolle spielt: Unser GOTT ist ein GOTT der Wunder tut.
Besonders an großen Feiertagen, sehr eindrucksvoll am Ostersonntag beim Abendgottesdienst wird aus der Mitte der Kirche heraus das große Prokimen gesungen,
Wer ist der große GOTT
wie unser GOTT
DU bist ein GOTT der Wunder tut!
Der Chor wiederholt den Vers. Auch an anderen Feiertagen steht dieses Prokimenon, dieser kurze Vers aus dem siebenundsiebzigsten Psalm, im Mittelpunkt der Verkündigung. Es ist etwas anderes, ob wir unseren GOTT besingen als einen GOTT der Wunder tut, oder ob wir über die Frage des Wunders und der Allmacht Gottes diskutieren. Unser GOTT ist ein GOTT der Wunder tut. Eine tägliche Erfahrung. Wenn wir auch oft nicht bemerken, wie GOTT DER HERR mit uns umgeht. Darum danken wir auch in dem Gebet der göttlichen Liturgie GOTT für alle Wohltaten, für alles, das ER für uns getan hat, für alles, was wir bemerkt haben, vor allen Dingen auch, was wir nicht bemerkt haben.
GOTT ist ein großer GOTT, unser GOTT ist der GOTT, der Wunder tut.
Der brennende Dornbusch, das Blut des Passa-Lammes
[14]
ist ein Vorbild, wie Meliton von Sardes
[15]
, (gestorben 180) in seiner Osterpredigt sehr deutlich gesagt hat, ein Vorbild kommender dynamischer Wirklichkeit.
Das Mysterium des Passa - Osterpredigt, 3.Vers
"Alt nach dem Gesetz
neu nach dem Wort
augenblickshaft nach dem Vorbild
ewig nach der Gnade
vergänglich durch die Schlachtung des Schafes
unvergänglich durch das Leben des HERRN
sterblich, durch das Grab in der Erde
unsterblich durch die Auferstehung der Toten
Ganz anders und noch viel realistischer wird es in Maria, der Mutter unseres HERRN JESUS CHRISTUS: Der alles verbrennende GOTT, das brennende Feuer, den niemand ertragen kann, der GOTT, der sich Elia und Moses, die in einer Höhle versteckt waren, offenbarte, wenn er vorübergeht, weil die Propheten sein Antlitz nicht erkennen können, wird Mensch aus Maria. GOTT ist brennendes Feuer, so daß Moses auf dem Berge Sinai einen Schleier vor sein Gesicht tun muß, damit die Menschen das Leuchten in seinem Angesicht ertragen können, nur deshalb, weil er in der Ferne mit GOTT geredet hat, als er wieder vom Berge herunterkommt
[16]
.
Dieser GOTT, von dem es heißt: es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen GOTTES zu fallen
[17]
, wird in dem Leib einer Frau, der Jungfrau Maria, Mensch. ER wird umschlossen von menschlicher Wirklichkeit, was in diesem Dornbusch als Bild und Wirklichkeit Moses erschienen ist, wird jetzt in Maria historische Wirklichkeit.
Aber damit noch nicht genug. Auch wir, die wir das Heilige Abendmahl empfangen, werden vom glühenden Feuer der göttlichen Gegenwart durchdrungen. Darum heißt es: Der, du hinzutrittst zum Empfang des Heiligen Abendmahls, erschrecke, Feuer ist es, was die Unwürdigen verzehrt. (Vers nach dem 12.Gebet):
"Siehe nun schreite ich zum göttlichen Abendmahl,
mein Schöpfer, verbrenne mich nicht durch die Vereinigung,
denn DU bist Feuer, das die Unwürdigen versengt;
reinige mich vielmehr von jedem Makel.
Erblickst Du das göttlich machende Blut,
dann erschaure, o Mensch!
Denn Feuer ist es, das die Unwürdigen verzehrt.
Gottes Leib vergöttlicht mich und nährt den Geist
Verstand vergöttlicht ER,
nährt wunderbar den Sinn"
Verse aus dem Gebet vor der Communion, nach dem 12.Gebet (Seite 184/5)
Und deshalb sind diese ganzen verschiedenen Bilder von denen ich jetzt eben gesprochen habe, der Dornbusch, die Mutter unseres HERRN JESUS CHRISTUS, als historische Wirklichkeit und unser Empfang des Heiligen Abendmahls ein dynamisches Geschehen, in dem der alles verbrennende GOTT sich uns Menschen so naht, in SEINER Menschwerdung, daß wir mit IHM umgehen, IHN mit unseren Händen und Lippen berühren können.
Diese seinshafte, ontologische und geschichtliche Dynamik, dieses Wachsen auf Gott zu läßt uns in den Bildern der Offenbarung des Johannes die Vollendung ahnen. (Nähe, Gegenwart Gottes: Der brennende Dornbusch, die Gottesgebärerin, der Empfang des Heiligen Abendmahls.)
Die Begegnung mit Gott wird immer dichter und vollständiger. Im Essen und Trinken des heiligen Leibes und kostbaren Blutes, unverständlich und doch für uns vollziehbar, hat Gott in uns Wohnung, verbindet uns der Herr gleichzeitig miteinander, die ER durch das heilige Abendmahl mit IHM und untereinander verbunden hat.
Im neuen Jerusalem ist kein Tempel, keine Sonne; Christus ist das schattenlose Licht der Stadt der Vollendung.
"und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott ist Tempel und das Lamm.
Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, daß sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm." Offenbarung,21,22-23
Der dreifaltige Gott offenbart sich durch die Geschichte des Alten und des neuen Bundes im Licht, in strahlender Helle:
"Herr erhebe über uns das Licht Deines Angesichtes" (Psalm 4,7)
"Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?" (Psalm 27,1, Prokimen der Taufe)
"Ja bei Dir ist die Quelle des Lebens, in Deinem Licht schauen wir Licht" (Psalm 36,10)
"und wird Deine Gerechtigkeit hervorbrechen, wie das Licht" (Psalm 31,6)
"Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke." (Matth.17.5)
Im Morgengottesdienst vor dem Gesang des großen Lobpreises ruft der Priester mit erhobenen Händen:
"Ehre sei DIR, der DU uns Licht gezeigt hast!"
In diesen Worten und Bildern der Heiligen Schrift ahnen wir, wird unser Verstand gedrängt über die gewohnten Denk Dimensionen hinauszugehen:
Gott der Herr ist Tempel und Licht, wir wachsen dem Tag des Herrn entgegen, da uns das schattenlose Licht, da uns Christus eine unbegreiflich herrliche Gemeinschaft mit IHM, in der strahlenden Helle des dreifaltigen Gottes, und Gemeinschaft durch IHN untereinander gibt.
O Mensch, der Du den Leib des HERRN empfangen willst
nahe Dich voll Furcht, verbrannt zu werden
Feuer ist es !
Darum denken die Gebete natürlich auch an den Propheten, der da Schwierigkeiten hatte das Wort GOTTES zu verkünden, weil er sagt: Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Auch so etwas hören wir nicht gerne, auch wenn wir das sehr leicht mitsprechen können. Es kommt der Engel, wieder eines dieser gehaltvollen Bilder der Heiligen Schrift, und nimmt die glühende Kohle vom Altar Gottes und mit dieser glühenden Kohle reinigt er die Lippen des Propheten, daß er das Wort GOTTES zu verkünden vermag
[18]
.
So nimmt auch uns GOTT auf, wenn wir das Heilige Abendmahl empfangen und deshalb die Vorbereitung, die Gebete. Die Gebete, die immer wieder gesprochen, oder gelesen werden, und die gleichzeitig unseren Verstand immer wieder neu auffordern, den Geheimnissen des Abendmahls nachzusinnen, nachzuspüren.
"Denn nicht unachtsam, sondern voll Zuversicht auf Deine unaussprechliche Gnade komme ich zu DIR, mein Gott, (Joh.20,28), damit ich nicht, auf lange Zeit fern von Deiner Gemeinschaft, dem listigen Wolf zum Raube werde (Apostg.20,29), Deshalb bete ich zu Dir, heilige, als der einzig Heilige Gebieter, meine Seele und meinen Leib, meinen Verstand und mein Herz, meine Nieren und mein Inneres und erneuere mich ganz..." (2.Gebet des Hl.Johannes Chrysostomos vor der Communion, Seite 171)
"Wort Gottes und Gott, möge mir die Feuerglut Deines Leibes, mir Verfinstertem, Licht spenden, und Dein Blut meiner Seele Reinigung von jeglichem Makel bringen." (5.Ode,2,Vers)
Wie ein Feuer und wie ein Licht möge Dir mein Leib werden, Erlöser, und Dein kostbares Blut, das den Sündenstoff verbrennt und das Dornengesträuch der Leidenschaften aufzehrt, und mich ganz erleuchtet, auf daß ich Deine Gottheit anbeten kann." (9.Ode,3.Vers)
Die Gegensätze, die Unvereinbarkeit, das Überraschende, das Unannehmbare des Wortes GOTTES öffnet uns in der Spannung des Herzens den Blick für eine neue, für die Wirklichkeit.
Unsere Liebe zu der Mutter des Herrn, der Immerjungfrau Maria, unsere Gesänge, die von ihr sagen, unsere Anrufung, die ihr unerschütterliche Hilfe zutraut, fordert immer wieder unseren Verstand heraus, der zweifelnd und zugleich zuversichtlich fragt: sind wir auf dem Boden der Wirklichkeit und des Glaubens, wenn wir sie preisen mit den Worten:
Die Du geehrter bist als die Cherubim
und unvergleichlich herrlicher, als die Seraphim
die Du unversehrt GOTT das Wort geboren hast
wahrhaftige GOTTES Gebärerin
Dich preisen wir
Es gibt keinen orthodoxen Gottesdienst, und auch keinen Hausgottesdienst, bei dem dieses Lied nicht gesungen wird.
Ja, mutet uns dieses Lied nicht auch wieder etwas zuviel zu?
Selbst, wenn wir die Mutter unseres HERRN JESUS CHRISTUS lieben und ehren, und wenn wir uns einfach wundern, über das, was dort alles geschieht, und was sie alles tut, und wie sie zu den Dienern in der Hochzeit zu Kanaan sagt: Was ER euch sagt, das tut; dann wird uns doch etwas unwohl, wenn es da heißt: die Du geehrter bist als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim. Vielleicht glauben wir gar nicht an die Cherubim und Seraphim, aber daß es ganz hohe Engelgestalten sind, und daß dieses Lied ein Lobpreis eines Menschen ist, der über alle menschlichen Maße hinausgeht, das begreift auch der, der weder an die Jungfrauengeburt, noch an die heiligen Engel glaubt.
In der 9.Ode singen wir:
"Der vom anfanglosen Vater gezeugte Sohn,
der Gott und Herr, DER Leib angenommen hat
aus der Jungfrau und uns erschienen ist,
um die von der Finsternis umgebenen zu erleuchten
und die Zerstreuten zu sammeln
um Seinetwillen preisen wir die allbesungene Jungfrau"
Und gerade dadurch werden wir im Beten durch unseren Verstand aufmerksam gemacht, daß hier etwas ganz ungewöhnliches ausgesagt wird.
Die Antwort ist natürlich, letzten Endes, einfach: "Die Du geehrter bist als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim", dann danach sofort die Erklärung: "die du unversehrt GOTT das Wort geboren hast. Wahrhafte GOTTES Gebärerin, Dich preisen wir."
Der Wert eines Menschen, eines Engels, eines Geschöpfes hängt nicht davon ab, welche Kleidung er trägt, hängt nicht davon ab, welches Einkommen er hat, hängt auch nicht von der Größe seines Verstandes oder der Schönheit seiner Stimme ab, sondern wird allein bestimmt durch die Nähe zu GOTT. Je näher ich bei GOTT bin, um so herrlicher bin ich. Je näher ich bei Gott bin, um so herrlicher erfahre ich mich selbst und die Welt um mich.
Und wer ist am nächsten bei GOTT ? So ist die Antwort für den einfachsten Denkakt ohne weiteres zu vollziehen. Dann ist es die Mutter des HERRN JESUS CHRISTUS. Niemand ist GOTT so nahe wie sie, in deren Leibe, in deren Schosse CHRISTUS wächst. ER, Gott, wird von ihr umschlossen. ER, wie das die Verse des Bußkanons des Andreas sagen, nimmt aus ihrem purpurfarbenen Blut Gestalt an. Es ist offensichtlich: Näher kann GOTT niemand sein. Und infolgedessen ist dieses Lied voll und ganz "berechtigt". Aber es ist eine Anrede an uns. Ich habe gesagt: der Verstand erschrickt vor dem Unwahrscheinlichen, nein, vor dem Ungewöhnlichen, was sich da ereignet, und bringt uns dahin, in eine neue Richtung zu blicken, um bei diesem Blick die eigentliche und wahre Wirklichkeit zu erkennen. Unsere ganzen Wertsysteme werden über Bord geworfen und uns wird gesagt, daß der eigentliche Wert für uns ist, bei GOTT zu sein.
Nach dem Empfang des heiligen Abendmahls danken wir dem Herrn in fünf Gebeten. Das letzte Gebet wendet sich an die Allerheiligste Gottesmutter:
"Allerheilige Gebieterin, Gottesmutter, du Licht meiner verfinsterten Seele, meine Hoffnung, mein Schutz, meine Zuflucht, mein Trost, meine Freude, ich danke Dir, daß du mich Unwürdigen gewürdigt hast, an dem allerreinsten Leib und dem kostbaren Blut Deines Sohnes teilzuhaben.
Du aber, die du das wahre Licht geboren hast, erleuchte die geistigen Augen meines Herzens, die du den Quell der Unsterblichkeit geboren hast, mache mich, den von der Sünde getöteten, lebendig..." (5.Gebet nach der Communion, Seite 190/1)
In der Panichida, bei der Feier der Grablegung, in der Liturgie sind die Entschlafenen mit uns verbunden. Es wird erfahrbar, daß des Todes trennende Macht zerbrochen ist.
Die Zusagen der Heiligen Schrift werden Wirklichkeit:
Psalm 118,17 :
ich werde nicht sterben, sondern leben,
und des Herrn Worte verkünden.
Matth.22.31-32:
Habt ihr aber nicht gelesen von der Toten
Auferstehung, was Euch gesagt ist von Gott,
der da spricht: ICH bin der Gott Abrahams
und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs?
Gott ist aber nicht ein Gott der Toten,
sondern der Lebendigen.
Johannes 5,25:
Wahrlich, ICH sage Euch: Es kommt die Stunde
und ist schon jetzt, daß die Toten werden
die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die
sie hören werden, die werden leben."
(Evangelium bei der Beerdigung)
Die Worte des Herrn ergreifen wir im Glauben, wenn und wo wir nach ihnen handeln. Glaube ist der Mut, die Bereitschaft und die Zuversicht nach dem Wort des Herrn zu handeln. So beten wir mit und für die Entschlafenen, wie wir mit und für die noch mit uns in dieser Zeit und Welt Lebenden beten.
Die Fürbitte ist ein Wort der Gemeinschaft, daß wir füreinander beten, ist nicht notwendig in einem kausal irdischen Zusammenhang, ist nicht "wirksam, als magisches Tun", sondern ist allein Ausdruck der Gemeinschaft, zu der uns Christus ruft, der der Schlußstein des Gewölbes der Kirche ist, deren lebendige Steine wir sind. Und zugleich lebt in unserer Fürbitte unser Vertrauen und unsere Liebe zu Gott, DER uns, seine Kinder und Erben, hört und unsere Bitte füreinander liebevoll annimmt.
Für das Gebet ist der Tod keine Grenze, im Beten sind wir, die hier Lebenden und die Entschlafenen, verbunden zu der einen großen Gemeinschaft der nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen, die in der Kirche ihre sichtbare Gestalt findet.
Die Auferstehung ist die Gewißheit der in Liebe und Gebet erfahrenen Gemeinschaft mit den Entschlafenen; das Gebet mit den Entschlafenen ist das Bekenntnis und die Erfahrung der Auferstehung Christi.
Oft werden wir gefragt: Wo ist Christus, der Auferstandene? Auch fragen wir uns selbst: ist die Auferstehung wahrhaft die Erneuerung und Wandlung der Welt? Im Gebet mit und für die Entschlafenen werden wir der Kraft und des Lichtes der Auferstehung Christi inne, geprüft von unserem Verstand und weit über alles hinaus, was uns der Verstand an Gewißheit geben kann.
Im Augenblick, wo wir aus der Auferstehung des HERRN JESUS CHRISTUS handeln, und Beten ist Handeln, bekennen wir wirklich, und erfahren wir wirklich, daß der HERR auferstanden ist von den Toten und keiner mehr im Grabe ist. Es heißt: als ER gekreuzigt wurde, taten sich viele Gräber auf, und die Toten erschienen vielen in Jerusalem
[19]
.
Die bekannteste Ikone von der Auferstehung Christi ist ein Bild von der Höllenfahrt oder besser des Hinabsteigens des Herrn in das Reich des Todes am Karsamstag, zwischen Karsamstag und Ostermorgen.
"Denn deshalb wurde auch den Toten des Evangelium verkündet, damit sie zwar Gericht erfahren als Menschen, dem Fleische nach, aber lebendig seien Im Hinblick auf Gott dem Geiste nach."
[20]
"Im Geiste ging auch er hin zu den Geistern im Gefängnis und predigte ihnen"
[21]
Die Ikone zeigt die zerbrochenen Tore der Totenwelt, des Hades, der Scheol. Christus steht auf den kreuzförmig übereinandergestürzten Torflügeln in einem strahlenden Licht, der Mandorla. Die Toten kommen von beiden Seiten, Johannes der Täufer führt sie zu Christus, wie er die Lebenden zur Umkehr gerufen hat. Christus streckt seine Hände aus und ergreift Adam und Eva, ER zieht sie aus der Welt und der Macht des Todes und ungezählte folgen ihnen und gehen auf Christus zu. Jeder entscheidet sich angesichts des Herrn, DER zu den Toten kommt - die Ikone zeigt, wie alle sich für Christus entscheiden, wie alle auf dem Weg zu IHM sind, DER das Leben ist und ihnen allen die Quelle des Lebens wird.
Mit der Auferstehung, mit dem Kreuzestod und der Auferstehung des HERRN JESUS CHRISTUS hat der Tod keine Macht mehr. Und diese Tatsache, daß er keine Macht mehr hat, die bestätigen wir, die erleben wir, die erfahren wir, wenn und wo wir mit und für die Entschlafenen beten.
Die Engel, sagt Athanasius von Alexandrien, die Engel können schwer zwischen lebendigen und toten Menschen unterscheiden. Was die Engel am Menschen wahrnehmen, ist, daß er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, ob er nun lebt, oder entschlafen ist, ist für die Engel unwichtig. Das ist etwas, das wir im Gebet wie die Engel erfahren; da wir für die Entschlafenen beten, sie so anreden, und mit ihnen so verbunden sind, wie mit denen, die noch auf dieser Erde leben und im Augenblick für uns vielleicht auch nicht sichtbar sind. Darum ist dieses Gebet von so großer Bedeutung, und verändert im Grunde genommen das Verhältnis zu unserem eigenen Tod, und zu den Entschlafenen. Die vielgestaltigen Bildvorstellungen der Menschheit über das Sein nach dem Tode spielen für mich keine Rolle mehr, wenn meine Gemeinschaft mit den Entschlafenen eine Gemeinschaft der Liebe und des Gebetes ist, wenn ich im Gebet mit ihnen verbunden bin.
Es sind lange und viele Gebete, ich werde nur ganz wenig vorlesen:
Gepriesen bist Du, o HERR
Lehre mich DEINE Weisungen
Ich bin das Bild DEINER unaussprechlichen Herrlichkeit
ob ich gleich die Wunden der Verfehlungen trage
Habe Erbarmen mit DEINEM Geschöpf GEBIETER
reinige es nach DEINER Herzensgüte
Schenke die ersehnte Heimat und mache mich
wieder zum Bewohner des Paradieses
In vielen dieser Gesänge der Panichida, dieses Gebetes, redet der Entschlafene zu uns. Er ist unmittelbar bei uns. Er verkündet uns den Glauben. Er wendet sich an uns. Auch in anderen Texten, wo er von der Schrecklichkeit des Todes spricht:
Gestern noch wandelte ich mit Euch
gestern noch sprachen wir miteinander
gestern noch hielten wir uns bei der Hand
das ist alles vorbei, aber nun erzählt er von dem, was sich dort ereignet:
Der Chor der Heiligen fand die Quelle des Lebens
und die Tür des Paradieses
o daß auch ich den Weg finden möge
durch Buße
ich bin das verlorene Schaf
rufe mich HEILAND zurück
und errette mich
Wie auch in allen westlichen Kirchenliedern sind die Gesänge und Gebete der Kirche nichts anderes, als die ständig neu zitierte Heilige Schrift:
"Der Chor der Heiligen fand die Quelle des Lebens."
Die Heiligen sind nicht besondere Leute, sondern heilig sind wir alle, die wir getauft sind. "Das Heilige den Heiligen" heißt es bei der Austeilung des Heiligen Abendmahles. Die Quelle des Lebens
[22]
und die Tür des Paradieses, ist CHRISTUS. O daß auch ich den Weg finden möge durch Buße, durch metanoia
[23]
, durch Umkehr. Und so ist dieses gemeinsame Gebet mit den Entschlafenen in der ausgeprägten Form der vielgestaltigen Gebete, der vielgestaltigen Gesänge dieses Gottesdienstes eine Erfahrung unserer Gemeinschaft mit denen, die von uns gegangen sind, eine Erfahrung, die durch das Denken getragen ist, in dem das Denken eine Welt öffnet, in die unser Herz eintritt und wir mit den Entschlafenen verbunden sind. So schließt das wieder zusammen, was ich zu Anfang gesagt habe: Der HERR hilft uns durch unser Denken, gerade vor dem Unwahrscheinlichen, vor dem Überraschenden, vor den unser alltägliches Leben überschreitenden Wirklichkeiten des Glaubens, der Begegnung mit den Entschlafenen, mit dem HERRN und mit der Mutter unseres HERRN JESUS CHRISTUS, aufmerksam zu sein für Gottes Gegenwart.
Das bedeutet nicht eine neue Welt zu erfahren, sondern endlich der Welt so inne zu werden, wie sie tatsächlich ist. Und die Maßstäbe auch unseres alltäglichen Lebens von dieser Wirklichkeit her zu nehmen, wie es in einem der Gebete heißt, die Perle zu suchen:
"Und abermals ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie."
[24]
In der Panichida: Ich bin das Bild von Deiner unaussprechlichen Herrlichkeit, ob ich gleich die Wunden der Verfehlungen trage: Habe Erbarmen mit Deinem Geschöpf, o Gebieter, und reinige es nach Deiner Herzensgüte. Schenke die ersehnte Heimat und mache mich wieder zum Bewohner des Paradieses.
6.Lied: Das Meer des Lebens sah ich aufgewühlt vom Sturm der Gefahren. Zu Deinem stillen Hafen bin ich gelangt und rufe zu DIR: Führe mein Leben aus der Vergänglichkeit, DU Allgütiger.
Metanoia, Hin-Wendung zu Gott, ist die Ahnung und der Weg zum Paradies. Je mehr wir im Beten und Denken uns selbst und unser ganzes Leben und einander in der Gemeinschaft mit den Entschlafenen Christo, unserem Gott befehlen und hingeben, um so mehr gewinnen wir die Perle, die von keiner Vergänglichkeit bedroht ist, das Leben mit und in Christo, das hier und jetzt im Gebet mit den Entschlafenen, wie im Empfang des heiligen Abendmahls Wirklichkeit, erlebte Wahrheit wird.
[1]
Orthodoxes Gebetbuch, München, ISBN 3-926 165 10 1 Seite 153-191
[2]
chodátai
[3]
die Ungetauften
[4]
Matth.5,8
[5]
Matth.13,45 ; Matth.19,29 ; Joh.21,22
[6]
Matth.22,1-14
[7]
2.Könige 5.5
[8]
1.Mose 3,21
[9]
2.Moses 39
[10]
Matth.22.13
[11]
Gal.3,27
[12]
2.Mose 3,5
[13]
Einheitsübersetzung 1980, Seite 63
[14]
2.Moses,12,13
[15]
Meliton von Sardes, Vom Passa, die älteste Osterpredigt, 1963 Sophia, Bd.3, Lambertus Verlag
[16]
1.Kor.19,13; 2.Mos.34,6; 2.Mos.34,33
[17]
Hebr.10,31; 2.Mos.15,11; 1.Tim.6,16;
[18]
Jes.6,5-7
[19]
Matth.27,52-53
[20]
1.Petrus,4,6
[21]
1.Petrus,3,19
[22]
Psalm 36,10; Off.22,17 ; Joh.7,38
[23]
Matth.3,2 ; Mark.1,4
[24]
Matth.13,45-46